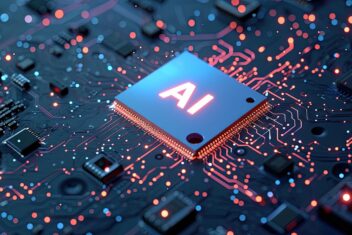Strategischer Einsatz von Künstlicher Intelligenz:Flywheel-Prinzip hilft, eine schnellere Rendite zu erzielen
17. September 2025
Viele KI-Initiativen scheitern daran, dass sie isoliert gestartet werden und nicht strategisch verankert sind. Die Folge: Der Weg zu einem messbaren Return on Investment ist versperrt. Aus Sicht von KI-Experten sollten Unternehmen daher den sogenannten Flywheel-Ansatz verfolgen. Dieser beschreibt, wie sich KI-Projekte gegenseitig antreiben, um einen echten Geschäftswert zu erzeugen.
„Flywheel“ bedeutet übersetzt Schwungrad und bezieht sich auf ein mechanisches Bauteil, das kinetische Energie speichert und verwendet, um die Drehung gleichmäßiger zu gestalten. Im Marketingkontext wird das Flywheel-Modell als ein Kreislaufkonzept verstanden, das den Kunden und die kontinuierliche Interaktion mit ihm in den Mittelpunkt stellt, um so ein positives Erlebnis zu schaffen und Wachstum zu generieren.
Dieser Gedanke lässt sich auch auf KI-Projekte übertragen. Fünf Prinzipien helfen, das KI-Flywheel in Gang zu setzen:
- Früh an den ROI denken statt spät evaluieren. Erfolgreiche KI-Initiativen beginnen nicht mit dem einfachsten, sondern mit dem wirkungsvollsten Projekt. Wer lediglich interne Pilotversuche unternimmt – etwa zur automatisierten Zusammenfassung von Besprechungsnotizen –, sammelt zwar Erfahrungen, schafft aber keine strategische Grundlage. Zielführender ist es, sich bereits bei der Projektplanung auf messbare Geschäftsergebnisse zu fokussieren. Das kann die Umsatzsteigerung durch personalisierte Produktempfehlungen, eine höhere Abschlussquote im Vertrieb durch eine intelligente Lead-Qualifizierung oder eine Kostenersparnis in der Lieferkette dank optimierter Prozesse sein. Eine ROI-orientierte Priorisierung legt das Fundament für eine nachhaltige Geschäftsentwicklung. Solche Erfolge sichern zudem die interne Akzeptanz und fördern die Investitionsbereitschaft.
- Ergebnisse in den Mittelpunkt rücken. Nicht alles, was sich technisch umsetzen lässt, bringt auch einen unternehmerischen Mehrwert. Oft werden KI-Projekte anhand ihrer Machbarkeit priorisiert und nicht nach ihrer strategischen Hebelwirkung. Das Ergebnis: operative Inseln. Der Flywheel-Ansatz setzt dagegen auf eine andere Logik. KI-Projekte sollten so gewählt werden, dass sie möglichst viele Folgeeffekte nach sich ziehen – beispielsweise durch die Erschließung neuer Datenquellen oder die Anbindung strategischer Systeme. Solche Use Cases wirken wie ein Antrieb: Sie steigern nicht nur die eigene Produktivität, sondern ebnen auch den Weg für künftige Innovationen.
- Investitionen als Kreislauf, nicht als Einzelmaßnahme verstehen. Jede Investition in KI – ob in Infrastruktur, Datenmanagement oder Modellentwicklung – sollte auf eine langfristige Wertschöpfung ausgerichtet sein. Das gelingt nur, wenn sie nicht isoliert betrachtet wird. Das Flywheel-Prinzip folgt einem klaren Mechanismus: Jedes erfolgreich abgeschlossene Projekt verbessert die Ausgangslage für das nächste. Die Infrastruktur wächst, Prozesse lassen sich standardisieren und Datenmodelle können wiederverwendet werden. Unternehmen profitieren damit gleich doppelt: durch Kosteneinsparungen aufgrund von Synergieeffekten und eine beschleunigte Umsetzungsfähigkeit.
- Fortschritte messbar machen und strategisch verankern. Manche KI-Projekte scheitern nicht am fehlenden Ergebnis, sondern an der fehlenden Sichtbarkeit. Fortschritte werden nicht dokumentiert, Erfolge nicht kommuniziert und Erkenntnisse nicht strategisch genutzt. Im Flywheel-Modell sind Transparenz und Messbarkeit integraler Bestandteil. Fortschritt bedeutet hier nicht nur technischer Output, sondern quantifizierbare Ergebnisse in Form von Kosteneinsparung, Produktivitätssteigerung, Zeitgewinn oder Innovationsfähigkeit. Diese gilt es zu erfassen – idealerweise über ein zentrales KPI-Framework, das von Fachabteilungen, IT und Management gemeinsam genutzt wird.
- Operative Basis stärken. Zwar ist die Auswahl des richtigen Projekts entscheidend, doch die Umsetzungsphase erfordert interne Richtlinien und die richtige Infrastruktur. Ein Governance-Framework stellt sicher, dass KI-Implementierungen mit den Geschäftszielen übereinstimmen und ethische Standards einhalten. Damit hilft es Unternehmen, Erfolge zu wiederholen, anstatt bei jeder neuen Initiative von vorne anzufangen. Ebenfalls wichtig ist die Schaffung einer einheitlichen technologischen Grundlage. Wiederverwendbare Plattformen auf Basis des Cloud-Betriebsmodells ermöglichen es Teams, Projekte mit weniger Zeit- und Kostenaufwand durchzuführen.
KI-Strategien entfalten ihre Wirkung nicht durch Einzellösungen, sondern durch ein ineinandergreifendes System. Hier setzt das Flywheel-Modell an: Das Schwungrad beschleunigt sich mit jeder Anwendung – die Datennutzung wird besser, Modelle leistungsfähiger, Prozesse automatisierter. Unternehmen profitieren von dem wachsendem Erkenntnisgewinn und müssen nicht jedes Mal von vorne beginnen. Und das wiederum garantiert einen schnelleren ROI.
Johann Strauss ist CTO AI Solutions von Dell Technologies.