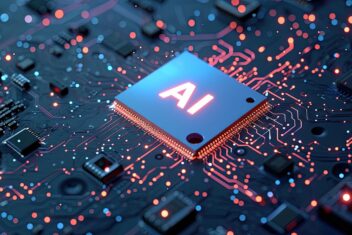Prognose zum Energiebedarf von Rechenzentren in EuropaKI-Technik lässt den Stromverbrauch im RZ massiv steigen
24. Oktober 2025
In den letzten zehn Jahren blieb der Stromverbrauch von Rechenzentren dank Effizienzsteigerungen durch technologische Innovationen relativ stabil. Das hat sich mit dem Aufkommen der KI geändert. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) wird sich der weltweite Stromverbrauch von Rechenzentren bis 2030 voraussichtlich mehr als verdoppeln, wobei KI einen großen Anteil daran haben wird. So verbraucht beispielsweise eine einzige ChatGPT-Abfrage fast zehnmal mehr Energie als eine Google-Suche.
Goldman Sachs prognostiziert, dass der weltweite Strombedarf von Rechenzentren bis Anfang 2025 55 GW erreichen und bis 2027 auf 84 GW steigen wird – ein Anstieg von mehr als 50 Prozent in nur zwei Jahren. Bis 2030 könnte die Kapazität 122 GW erreichen.
Auch die Leistungsdichte steigt: Der Verbrauch pro Quadratmeter wird bis 2027 voraussichtlich von 1,74 MW auf 1,89 MW steigen. KI-spezifische Hardware ist ein wesentlicher Faktor für diesen Anstieg. Daher stellt sich die Frage: Kann die Stromerzeugung mithalten?
Der wachsende Energiebedarf von Rechenzentren kollidiert mit einer veralteten und ineffizienten Infrastruktur. In den USA ist laut der North American Electric Reliability Corporation fast die Hälfte des Landes in den nächsten zehn Jahren einem erhöhten Risiko von Stromausfällen ausgesetzt. Dies ist auf stillgelegte Kraftwerke, Verzögerungen beim Neubau und einen steigenden Bedarf zurückzuführen.
Weltweit sieht das Bild ähnlich aus. Schätzungen zufolge werden bis 2040 mehr als die Hälfte der derzeitigen Kraftwerke in Großbritannien und der EU stillgelegt, obwohl der Strombedarf zwischen 2022 und 2050 voraussichtlich um fast 80 Prozent steigen wird. Grund dafür ist der Wunsch, sich von fossilen Brennstoffen wie Kohle unabhängig zu machen.
Ist Atomkraft die Lösung?
Angesichts dieser drohenden Lücke entwickelt sich die Kernenergie zu einem wichtigen Faktor im zukünftigen Energiemix – sowohl zur Deckung des Bedarfs als auch zur Unterstützung der Dekarbonisierungs-Bemühungen. Die IEA geht davon aus, dass sich der Anteil der Kernenergie an der Stromerzeugung bis 2050 fast verdoppeln wird.
Der IEA zufolge befinden sich derzeit weltweit 63 Kernreaktoren mit einer Gesamtleistung von mehr als 70 GW im Bau. Der Großteil dieser Aktivitäten findet jedoch in Russland und China statt. Im Gegensatz dazu sind in den G7-Ländern rückläufige Investitionen und die Stilllegung alter Anlagen zu verzeichnen.
SMRs: Eine Kernkraftlösung für Rechenzentren
Eine vielversprechende Entwicklung sind kleine modulare Reaktoren (Small Modular Reactors, SMRs) – kompakte Kernreaktoren, die bis zu 300 MW leisten und mit Mikroreaktoren von nur 10 MW ausgestattet sind. SMRs sind vorgefertigt, einfacher zu installieren und schneller in Betrieb zu nehmen als herkömmliche Kraftwerke.
SMRs könnten in Rechenzentren integriert werden, um diese mit CO2-freiem Strom zu versorgen. Während der Bau herkömmlicher Kernkraftwerke acht bis zehn Jahre dauert, könnten SMRs in nur zwei bis drei Jahren einsatzbereit sein. Das ist zwar immer noch langsamer als der Bau von Rechenzentren, aber ein Schritt in die richtige Richtung.
Doch die SMRs sind in großem Maßstab noch weitgehend unbewährt und nur in sehr wenigen Fällen kommerziell in Betrieb – dies könnte sich jedoch in den kommenden Jahrzehnten mit steigender Nachfrage rasch ändern. Während Kernkraft zwar zur Lösung langfristiger Kapazitätsprobleme beitragen kann, benötigen Rechenzentren auch sofortige Lösungen, um den Energieverbrauch zu senken.
Das bedeutet, dass jeder Bereich des Energieverbrauchs im Rechenzentrum genau unter die Lupe genommen werden muss: vom Netzwerk über die Rechenleistung bis hin zur Datenspeicherung und allen damit verbundenen Kühlungs- und Stromanforderungen. Nur durch den Einsatz der energieeffizientesten Lösungen im gesamten Rechenzentrum können Unternehmen hoffen, die Auswirkungen von KI und Energieengpässen abzumildern.
Ein Teil der Lösung könnte darin bestehen, ineffiziente, veraltete Festplatten (HDDs) zugunsten von All-Flash-Datenspeichern aus dem Verkehr zu ziehen. Flash-Speicher sind deutlich energieeffizienter als HDDs, die nach wie vor einen Großteil des Speichers in Rechenzentren ausmachen. Im Gegensatz zu HDDs haben Flash-Speicher keine beweglichen Teile und verbrauchen daher 5- bis 10-mal weniger Strom.
Flash-Speicher sind zwar grundsätzlich effizienter als HDDs, aber weiterentwickelte, fortschrittliche Flash-Speichersysteme bieten noch größere Vorteile. Standard-SSDs, deren Kapazität oft auf etwa 20 bis 30 TB pro Laufwerk begrenzt ist, können den Energieverbrauch nur begrenzt senken. Einige Speicheranbieter bieten jetzt Flash-Module mit hoher Dichte an, die als Teil integrierter Systeme konzipiert sind.
Diese Module minimieren die Anzahl der integrierten Komponenten wie RAM und setzen auf Optimierung auf Systemebene. Das Ergebnis sind bis zu fünfmal höhere Energieeffizienz als Standard-SSDs, 85 Prozent weniger CO2-Emissionen und eine drei- bis sechsmal höhere
Zuverlässigkeit im Vergleich zu SSDs und HDDs
Angesichts wachsender KI-Workloads und steigender Energieanforderungen von Rechenzentren gibt es keine Patentlösung, sondern es sind mehrere Strategien erforderlich. Kernenergie, insbesondere SMRs, könnte langfristig dazu beitragen, die Versorgungslücke zu schließen.
Kurzfristig bieten effizientere Rechenzentrumstechnologien wie All-Flash-Speicher einen klaren und unmittelbaren Weg zu mehr Effizienz.
Patrick Smith ist Field CTO EMEA bei Pure Storage.