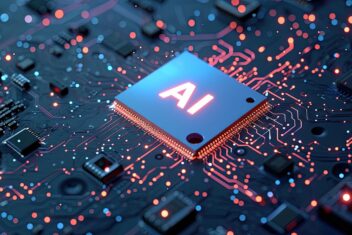So gestalten Chief Experience Officer Modernisierung erfolgreichLegacy-Systeme meistern
31. Oktober 2025
Für Chief Experience Officer (CxOs) erweist sich das Legacy-System des Unternehmens sowohl Ausgangspunkt, als auch Herausforderung. Veraltete Systeme, die oft zentrale Geschäftsprozesse ausführen, dominieren die Infrastruktur. Sie steuern die Gehaltsabrechnung, die Logistik, die Rechnungsstellung und die Kundendaten. Dennoch sind sie häufig unsichtbar, schlecht dokumentiert und widerstandsfähig gegenüber Veränderungen.
Modernisierungs-Forderungen kommen aus allen Richtungen: Regulierungsbehörden verschärfen die Vorschriften, Entwickler fordern bessere Tools und Vorstände erwarten digitale Agilität. Der CxO steht in der Mitte – egal, ob er den Titel CIO (Chief Information Officer), CTO (Chief Technology Officer) oder CFO (Chief Financial Officer) trägt. Und der Druck wächst.
Die Faszination moderner Architekturen ist groß. Die Best Practices heutzutage beginnen oft mit einem Neuanfang: alles in die Cloud migrieren, alte Programmiersprachen durch moderne ersetzen, Microservices einführen und kontinuierliche Bereitstellungspipelines ermöglichen. Das verspricht elegante Einfachheit – flexibel, skalierbar und zukunftssicher. Die Architektur ist darauf ausgelegt, sich anzupassen, nicht nur zu funktionieren. Teams können schnell veröffentlichen, schnell scheitern und schnell Fehler beheben. Für viele ist dies das Ideal: ein System, das Veränderungen fördert, anstatt sich ihnen zu widersetzen.
Doch jeder, der schon einmal eine Neuprogrammierung mitgemacht hat, weiß es besser. Projekte werden überzogen. Anforderungen ändern sich. Eingebettete Logik verschwindet. Das Geschäftsrisiko steigt. Warum? Weil Optimismus mit dem Umfang der Altlasten kollidiert. Was aus der Ferne einfach aussieht, erweist sich bei näherer Betrachtung als komplex.
Es ist wie bei der Planung einer Hausrenovierung, bei der man feststellt, dass die Wasserleitungen durch die Wände verlaufen, die man eigentlich einreißen wollte. Für Unternehmen mit jahrzehntelangem Code, Daten und Prozessen erweist sich eine Neuprogrammierung oft als Illusion – ambitioniert, aber selten praktikabel.
Das bedeutet nicht, dass Modernisierung ausgeschlossen ist. Sie muss nur anders angegangen werden – und wenn sie richtig umgesetzt wird, liefert sie Ergebnisse. Fortschritte werden sichtbar, Risiken werden eingedämmt, und Systeme, die einst unbeweglich schienen, beginnen, auf Veränderungen zu reagieren.
Mehr noch: Legacy-Systeme beginnen, sich im wahrsten Sinne des Wortes zu bewähren. Sie verdienen ihren Platz, indem sie sich anpassen und nicht nur bestehen bleiben. Und wenn Ihnen das schwer zu glauben fällt, fragen Sie sich selbst: Warum haben diese Systeme so lange Bestand gehabt? Diese Antwort darauf zu erkennen, ist der wahre Zustand der IT-Meditation: eine stille Erkenntnis, dass Ausdauer in Verbindung mit Anpassungsfähigkeit ein mächtiger Vorteil ist.
Neudenken der Erzählung
Bei der Modernisierung geht es nicht darum, zwischen Alt und Neu zu wählen. Es geht darum, den relativen Nutzen und das relative Risiko zu verstehen. Ein komplett neu konzipiertes System mag zwar ultimative Flexibilität bieten, aber die Risiken – Unterbrechungen, Verzögerungen, Kosten, Wissensverlust – sind erheblich.
Eine schrittweise Modernisierung – die Einführung moderner Tools, APIs, Container, CI/CD-Pipelines – kann die Lieferzeiten verkürzen, die Integration verbessern und die Einarbeitung von Entwicklern erleichtern. Sie liefert vielleicht nicht die klaren Linien einer vollständigen Neuprogrammierung, aber sie kann das Unternehmen sinnvoll voranbringen. Ein kleiner Schritt in der Modernisierung von Legacy-Systemen ist oft ein großer Schritt für die Bereitstellung.
Die Realität der Altsysteme
Altsysteme sind aus gutem Grund schwierig: Es mangelt an Fachkräften. Der Umfang ist enorm. Und oft schüchtert es ein, weil niemand derjenige sein möchte, der das System kaputt macht, das das Unternehmen seit dreißig Jahren still und leise am Laufen hält.
Umgekehrt gibt es immer wieder den enthusiastischen Ruf nach einem „Rip and Replace” – ein Schlachtruf für einen Neuanfang, oft ohne vollständiges Verständnis dafür, was auf dem Spiel steht. Das klingt mutig, sogar visionär. Aber ohne Vorsicht kann dieser Ruf zu einer Grabrede werden: RIP – nicht nur für das System, sondern auch für die Stabilität, die dadurch einst gewährleistet wurde. Und nicht zuletzt für den CIO. Ungezügelter Ehrgeiz kann, wenn er auf die wahre Größe und Komplexität der Altlasten trifft, mutige Pläne in Karriereepitaphien verwandeln.
Legacy-Systeme als ein Problem zu verwerfen, das es zu beseitigen gilt, ignoriert jedoch ihren Wert: jahrelange Geschäftslogik, Compliance-Bewusstsein, operative Ausfallsicherheit und über die Zeit optimierte lineare Leistung. Diese Systeme wurden nicht für schnelle Änderungen entwickelt – sie wurden für einen zuverlässigen Betrieb in großem Maßstab mit Vorhersagbarkeit konzipiert. Das macht sie nicht obsolet, sondern bewährt.
Systeme wie der Mainframe wickeln nach wie vor einen Großteil der weltweiten Kerngeschäfts-Transaktionen ab. Der Mainframe ist keineswegs ein Relikt, sondern bietet ein Maß an Zuverlässigkeit, Sicherheit und Durchsatz, das viele moderne Plattformen noch immer zu erreichen versuchen. Anstatt Legacy-Systeme zu verwerfen, ist es nachhaltiger, sie weiterzuentwickeln – sie beobachtbar, testbar und veränderbar zu machen. Unternehmen sollten nutzen, was funktioniert, und modernisieren, was das Geschäft behindert.
Die Nachfragewelle überstehen
CIOs sehen sich einer Welle der Frustration gegenüber. Interne Teams möchten schnellere Lieferzeiten, Produktverantwortliche wünschen sich digitale Funktionen, Auditoren fordern Compliance. Gleichzeitig mischen sich auch Experten ein, die nicht aus dem Legacy-Bereich kommen: Berater schlagen einen kompletten Neuaufbau vor, Cloud-Anbieter drängen auf eine vollständige Migration. „Wechseln Sie zu unserer Cloud“, sagen sie, als ob die Infrastruktur allein alle Probleme lösen würde. Unter Druck besteht die Versuchung, eine umfassende Transformation zu versprechen.
Glaubwürdigkeit entsteht jedoch durch Ergebnisse. Der CxO, der greifbare Fortschritte vorweisen kann – Modernisierung eines Schlüsselsystems, Integration von Cloud-Diensten, Reduzierung manueller Prozesse – verändert die Stimmung. Frustration weicht Zuversicht. Die Diskussion dreht sich nun darum, was möglich ist, und nicht mehr nur darum, was nicht funktioniert.
Regulierung als Beschleuniger
Regulatorischer Druck kann eine nützliche Triebkraft sein. Gesetze wie der Digital Operational Resilience Act (DORA) und NIS2 verlangen Resilienz – und zwingen CIOs dazu, nicht wegen eines Trends, sondern aus Gründen der Überprüfbarkeit, Kontinuität und Kontrolle zu modernisieren. Externe Dringlichkeit schafft interne Übereinstimmung. Sie schärft die Argumente für Veränderungen und öffnet die Tür für Investitionen.
Um Altlasten zu überwinden, braucht es keine Taktik, sondern eine Strategie. Das bedeutet:
- Einschätzung: Unternehmen müssen verstehen, was sie haben – den Anwendungswert, die technischen Schulden und die gegenseitigen Abhängigkeiten.
- Roadmap: Unternehmen müssen entscheiden, was beibehalten, was auf die Cloud umgestellt, was ausgemustert und was umgestaltet wird.
- Kommunikation: Abstimmung mit Stakeholdern, Festlegung von Erwartungen, Teilen von Erfolgen. Der CxO, der mit Strategie führt und durch Maßnahmen liefert, schafft Vertrauen. Mit der Zeit werden Forderungen nach radikalen Veränderungen zu Chancen für gemessenen Fortschritt.
Letztendlich sind Altlasten nicht der Feind, aber sie müssen nicht ignoriert werden. Die Aufgabe des CxO ist es, Dringlichkeit in Umsetzung, Ambitionen in Architektur und Lärm in Dynamik zu verwandeln. Modernisierung muss nicht bedeuten, neu anzufangen. Es bedeutet, dort anzufangen, wo Unternehmen sind – und zu wissen, wohin sie gehen.
Scot Nielsen ist Vice President Product Management bei Rocket Software.