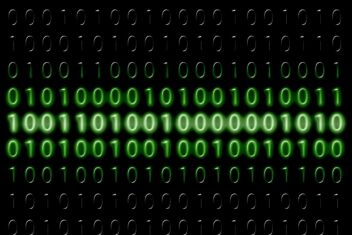KI stellt sich dem Alltag: So gewinnt KI Relevanz für Unternehmen
28. November 2025
Aufgaben, die früher stundenlange manuelle Datenerfassung und -prüfung erforderten, schaffen heute Freiräume für tiefere, strategische Analysen – dank künstlicher Intelligenz. Was einst nach Zukunftsmusik klang, ist inzwischen Teil des Arbeitsalltags vieler Fachbereiche.
Die eigentliche Stärke von KI liegt nicht nur in der Automatisierung, sondern darin, Menschen gezielt zu unterstützen. Wenn Experimentierfreude auf die richtigen Werkzeuge trifft, entstehen Räume für Kreativität, Problemlösung und Zusammenarbeit.
Ein gutes Beispiel liefert Cognizant: Dort sind bereits 90 Prozent der Routineaufgaben im Reporting automatisiert – Zeit, die nun in wertschöpfende Tätigkeiten investiert wird.
Im Realitätscheck: Zwischen Anspruch und Umsetzung
Trotz sichtbarer Erfolge bleibt eine Lücke zwischen Potenzial und Realität. Laut der Global Practitioner Studie von Workiva nutzen 74 Prozent der befragten Fachkräfte täglich KI. Gleichzeitig fehlen in vielen Unternehmen jedoch grundlegende Voraussetzungen:
- hochwertige, verlässliche Daten,
- klare Governance-Regeln sowie
- geeignete Tools und gezielte Schulungen.
Das zeigt: Die Herausforderungen sind nicht nur technischer Natur – sie betreffen ebenso Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft. Wahre Reife im Umgang mit KI entsteht erst, wenn Technologie, Menschen und Führung auf gemeinsame Ziele ausgerichtet sind. Mit dem Wandel der Arbeitsweise verändern sich auch Rollenbilder, Teamdynamiken und die Art der Zusammenarbeit. Viele Unternehmen stehen dabei noch am Anfang.
Ohne vertrauenswürdige Daten – keine vertrauenswürdige KI
Das größte Hindernis beim erfolgreichen Einsatz von KI ist nicht die Technologie selbst, sondern das Datenfundament: Es braucht saubere, vernetzte und vertrauenswürdige Informationen. Doch genau hier liegt oft das Problem. Besonders in Bereichen wie der Nachhaltigkeitsberichterstattung stammen Daten häufig aus isolierten Systemen oder basieren auf manuellen Eingaben – mit entsprechend hohem Prüfaufwand. Fehlt das Vertrauen in die eigene Datenbasis, leidet nicht nur die Glaubwürdigkeit KI-gestützter Ergebnisse – auch das Risiko fehlerhafter Entscheidungen steigt deutlich.
Fehlen klare Governance-Strukturen, die auf Leitungsebene verankert und in die Unternehmensstrategie integriert sind, birgt die Skalierung von KI erhebliche Risiken – operative und ethische. Der Einsatz leistungsstarker Tools ohne klare Kontrollmechanismen ist wie eine Sportwagenfahrt ohne Bremsen: beeindruckend schnell – aber nicht steuerbar.
Daten- und Governance-Lücken wirken sich direkt auf Mitarbeitende aus. Studien zeigen, dass Beschäftigte im Schnitt:
- 3,6 Stunden pro Woche mit interner Kommunikation verbringen,
- 2,8 Stunden mit der Suche nach Informationen beschäftigt sind und
- 2,2 Stunden in ineffizienten Meetings sitzen.
Das entspricht fast einem vollen Arbeitstag pro Woche – Zeit, die nicht in Ergebnisse, sondern in Prozesse fließt.
Führung mit Weitsicht: KI braucht klare Verantwortung
Die erfolgreiche Einführung von KI ist vor allem eine Frage klarer, vorausschauender Führung. Entscheidend ist, dass sie nicht isoliert gedacht, sondern als funktionsübergreifende, strategische Aufgabe im gesamten Unternehmen verankert wird. Sie beginnt nicht allein beim CIO – vielmehr braucht es die aktive Unterstützung und enge Zusammenarbeit aller Führungskräfte im Unternehmen.
Eine KI-Einführung ist immer auch ein Thema des Change Managements und des kulturellen Wandels: Es gilt, eine Unternehmenskultur zu fördern, die offen für Innovation ist, datengestützte Entscheidungen unterstützt und so den größtmöglichen Mehrwert ermöglicht. Bei Workiva startet jede KI-Initiative mit einer einfachen, aber wirkungsvollen Frage: „Welches konkrete Business-Ziel wollen wir mit diesem Einsatz erreichen?“ Denn nur wenn Ziel, Technologie und Umsetzung klar aufeinander abgestimmt sind, kann KI ihr volles Potenzial entfalten.
Vier Erfolgsfaktoren für eine tragfähige KI-Strategie
Auch wenn jedes Unternehmen seinen eigenen Weg geht, lassen sich vier übergeordnete Grundprinzipien ableiten:
- Datenqualität und -vernetzung haben höchste Priorität; ohne saubere Daten ist kein nachhaltiger KI-Einsatz möglich.
- Bestehende Plattformen effizient nutzen; neue Lösungen sollten bestehende Systeme integrieren, um Reibungsverluste zu minimieren.
- Governance strukturiert entwickeln und verankern; Regeln zu Ethik, Sicherheit und Compliance sollten gemeinsam mit Stakeholdern entwickelt und im Kleinen getestet werden.
- Mitarbeitende befähigen; KI muss nicht nur angewendet, sondern auch verstanden werden – Schulungen und Kontextwissen sind entscheidend.
Vertrauen entsteht durch Umsetzung – nicht durch Abwarten
Dort, wo Unternehmen in hochwertige Daten, belastbare Governance und gezielte Weiterbildung investieren, wächst das Vertrauen in KI – und damit die Fähigkeit, sich von repetitiven Aufgaben zu lösen und sich auf Analyse, Innovation und Wirkung zu konzentrieren. Die Schließung der KI-Lücke erfordert Zusammenarbeit über Silos hinweg: IT, Fachbereiche und Führungskräfte müssen gemeinsam agieren. Nur so wird aus technologischem Potenzial auch messbarer Nutzen.
Vertrauen in KI ist unverzichtbar. Doch echter Mehrwert entsteht erst durch klare Prioritäten, disziplinierte Umsetzung und strategische Führung. Reife zeigt sich nicht an der Geschwindigkeit der Einführung, sondern an der Qualität des Fundaments. Am Ende stellt sich eine zentrale Führungsfrage: Warten wir, bis KI von selbst Mehrwert bringt – oder gestalten wir heute das Fundament, das morgen Erfolg ermöglicht? Die Zukunft der Arbeit hängt genau davon ab.
Corinna Krestel ist Senior Consultant DACH bei Workiva.